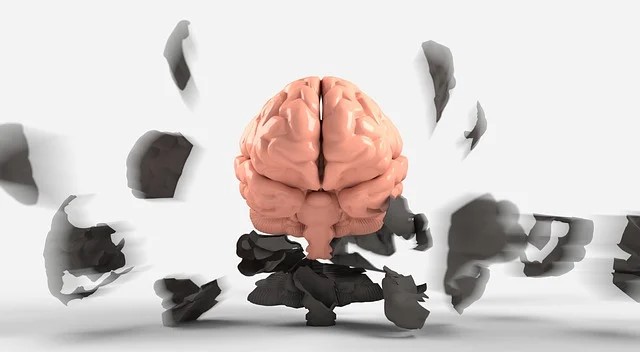Zusammenfassung Werden äußere sozioemotionale Signale je nach den inneren Zuständen unseres Körpers vom Gehirn unterschiedlich wahrgenommen? In dieser Studie bewerten wir, ob die Wahrnehmung der emotionalen Zustände anderer von internen interozeptiven Zuständen abhängt, indem wir multimodale Maßnahmen (Verhaltensexperimente, Elektrophysiologie, Gehirnanatomie und Gehirnnetzwerkkonnektivität) bei gesunden Kontrollpersonen und Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen (Alzheimer-Krankheit, Parkinson und frontotemporale Demenz). Unsere Studie legt nahe, dass sich die Wahrnehmung von Emotionen verbessert, wenn sich Menschen auf ihre eigenen inneren Körperzustände konzentrieren (Herzinterozeption), begleitet von Modulationen auf der Ebene des Verhaltens, der Elektrophysiologie, der Neuroanatomie und der Gehirnkonnektivität. Darüber hinaus weist die frontotemporale Demenz, eine Erkrankung, die durch sozioemotionale Defizite gekennzeichnet ist, konvergente und multimodale neurokognitive Marker für interozeptive Störungen während der emotionalen Verarbeitung auf (selektive Verhaltensdefizite, Modulationen abnormaler evozierter Potenziale des Herzens, insular-cinguläre Atrophie und Veränderungen des Salienznetzwerks). im Vergleich zu Patienten mit Alzheimer, Parkinson und Kontrollpersonen. Diese Ergebnisse stützen ein prädiktives Kodierungsmodell von Emotionen, das auf interozeptiven Zuständen basiert, und legen auch eine unzureichende allostatische Belastung bei frontotemporaler Demenz nahe. |
| Alles richtet sich nach dem Körper, mit dem Sie aussehen |
Die Außenwelt um uns herum wird nicht reflexiv oder passiv wahrgenommen. Wir lernen, die Realität auf der Grundlage unseres eigenen Bedeutungsgeflechts wahrzunehmen, das jedem von uns teils ähnliche, teils unterschiedliche Perspektiven bietet. In Ramón de Campoamors Gedicht heißt es wunderbar, „ dass es in der tückischen Welt / keine Wahrheit und keine Lüge gibt: / alles richtet sich nach der Farbe / des Glases, mit dem man schaut “, und fängt den inneren Blick ein, mit dem wir wahrnehmen und in dem wir handeln die Welt.
Die kognitive Neurowissenschaft hat sich stark dem Verständnis gewidmet, wie unser Gehirn die Außenwelt wahrnimmt (insbesondere im Fall unseres visuellen Systems), und dabei oft vergessen, dass das Gehirn selbst ein Kristall ist, der festlegt, wie wir wahrnehmen. Aktuelle Ansätze zur situierten und verkörperten Kognition erinnern uns jedoch erneut daran, dass unser Körper und seine Umstände mehr als nur ein leistungsstarker Filter sind, durch den wir die Realität beobachten.
Insbesondere die Bedeutung der internen Signale des Organismus aus der Untersuchung der Interozeption – Prozesse, durch die das Gehirn Informationen über Körperzustände tadelt, integriert und sendet – hat enorm an Relevanz gewonnen. Imhotep in Ägypten warnte vor mehreren Jahrtausenden, dass der Blutfluss des Herzens das Gehirn beeinflusst, und einige griechische Philosophen schlugen vor, dass Herz und Darm die Motoren des Geistes seien.
Aber es war William James, ein amerikanischer Philosoph und Psychologe, der viel später vorschlug, dass die Wahrnehmung von Emotionen eine körperliche Grundlage hat. Für ihn lag der Ursprung der Emotionen in den Eingeweiden. Später führte Sherrington den Begriff Interoception ein . Dennoch dauerte es lange, bis der Körper in den heutigen kognitiven Neurowissenschaften eine führende Rolle einnahm.
| Die Gefühle anderer unter dem Glas unseres Körpers |
Interozeptive Prozesse lassen sich auf sehr einfache Weise evaluieren, beispielsweise durch Aufgaben, bei denen die Teilnehmer ihrem Herzschlag folgen . Basierend auf dieser Aufgabe ist eine neue klinisch-therapeutische Agenda für zahlreiche psychiatrische und neurologische Erkrankungen entstanden , darunter Depression, Angstzustände, Anorexie, Depression, Schlaganfall, Bluthochdruck, Demenz und sogenannte Funktionsstörungen. In jüngerer Zeit wurde vermutet , dass interozeptive Prozesse die soziale Wahrnehmung (Empathie, soziale Entscheidungsfindung) und Emotionen beeinflussen könnten .
Die Theorie der interozeptiven prädiktiven Kodierung schlägt vor, dass interozeptive Zustände in zukünftigen Vorhersagen (oder Bayes’schen Schlussfolgerungen) auf der Grundlage früherer körperlicher Erfahrungen verwendet werden, was die Wahrnehmung externer sozialer Phänomene beeinflusst . Bisher konnte jedoch nicht schlüssig nachgewiesen werden, dass sich verändernde interozeptive Zustände auch auf die Wahrnehmung der äußeren sozialen Welt und deren Gehirnkorrelationen verändern.
| Wie unser Körper die Wahrnehmung von Emotionen beeinflusst und wie diese durch neurodegenerative Erkrankungen beeinflusst wird |
Kognitive Neurowissenschaften und Verhaltensneurologie haben begonnen, interozeptive Zustände als zentrale Modulatoren von Emotionen (und insbesondere negativen Emotionen wie Ekel, Wut oder Wut) hervorzuheben. Allerdings mangelt es auf diesem Gebiet an experimentellen Designs, die die Emotionswahrnehmung durch Interozeption und deren Gehirnkorrelation manipulieren.
In dieser Studie haben wir eine experimentelle Aufgabe entworfen, die Bedingungen der interozeptiven Fokussierung des Herzens (auf den eigenen Herzschlag achten) und der exterozeptiven Kontrolle (auf einen ewigen Klang achten) beinhaltet, gefolgt von der Präsentation von Gesichtsemotionen, bei denen die Teilnehmer die Art der Emotion erkennen müssen . .
Wir haben 114 Teilnehmer rekrutiert, darunter gesunde Kontrollpersonen und Patienten mit verhaltensbedingter frontotemporaler Demenz (bvFTD), Parkinson-Krankheit (PD) und Alzheimer-Krankheit (AD). Während der Aufgabe haben wir Modulationen der kortikalen Gehirnaktivität (mit EEG, Beurteilung des vom Herzen hervorgerufenen Potenzials (HEP)) und deren Zusammenhang mit Mustern der Anatomie und funktionellen Konnektivität gemessen.
Auf der Leistungsebene zeigten nur bvFTD-Patienten im Vergleich zu Kontrollpersonen Defizite bei der Verfolgung ihrer interozeptiven Körperzustände. Im letzteren Fall führte das interozeptive Targeting des Herzens zu einer besseren Erkennung negativer Emotionen (im Vergleich zur Kontrollaufgabe), dieser Effekt wurde jedoch bei Patienten mit bvFTD aufgehoben. Die kardiale kortikale Aktivität (HEP) nahm während der Erkennung negativer Emotionen zu, jedoch nur im Zustand der interozeptiven Fokussierung des Herzens, sowohl bei den Kontrollpersonen als auch bei AD.
In allen Gruppen war das Erkennen negativer Emotionen während der interozeptiven Fokussierungsaufgabe des Herzens mit einem erhöhten Volumen der Insula und des anterioren cingulären Kortex verbunden , zwei entscheidenden Regionen der interozeptiven und allostatischen Regulierung. Darüber hinaus war die Erkennung negativer Emotionen mit der Konnektivität des Salienznetzwerks (ein interozeptiv-allostatisches Netzwerk) bei der interozeptiven Fokussierungsaufgabe des Herzens und mit dem exekutiven Netzwerk bei der externen Reizkontrollbedingung verbunden.
Die Aktivität des Salience-Netzwerks war in Bezug auf die interozeptive emotionale Erkennung bei bvFTD beeinträchtigt. Unsere Ergebnisse legen insgesamt nahe, dass interozeptive Zustände die Emotionserkennung und deren Gehirnkorrelation prägen und gleichzeitig einen spezifischen pathophysiologischen Marker für bvFTD aufdecken. Diese Ergebnisse bieten eine vielversprechende theoretische und klinische Agenda zum Verständnis von Interozeption, Emotion, Allostase und Neurodegeneration.
| Bringen Sie den Körper zur Wahrnehmung der Realität zurück |
Die Untersuchung der Interaktion zwischen inneren Körpersignalen und Emotionen wird in den kognitiven Neurowissenschaften, der Psychiatrie, der Neurologie und verwandten Disziplinen seit langem kontrovers diskutiert . Diese Studie hat in Verbindung mit anderen Ergebnissen theoretische und klinische Implikationen. Die Konstruktion subjektiver Körperzustände durchdringt vielfältige Prozesse der Außenwahrnehmung.
Angesichts der Tatsache, dass die Verarbeitung der Emotionen anderer (und anderer externer Objekte) scheinbar von der eigenen viszeralen Wahrnehmung abhängt, könnten viele klinische Praktiken durch ein besseres Verständnis der Interozeption verbessert werden. Dies wird zu einem wesentlichen Bestandteil der Allostase , der auf physiologischen Bedürfnissen und inneren Zuständen basierenden Antizipation externer Signale und Kontexte. Dies eröffnet neue Wege für eine klinische Agenda an der Schnittstelle von kognitiver Neurowissenschaft, Psychiatrie und kognitiver Neurologie .
Anscheinend nutzt das Gehirn die inneren Zustände des Körpers, um die Bedürfnisse des Kontexts zu antizipieren und die anpassungsfähigsten Reaktionen zu definieren.
Im Fall von Herzschlägen und anderen viszeralen Signalen deutet dies darauf hin, dass die Wahrnehmung externer sozioemotionaler Informationen ein aktiver Prozess ist, der auf eigenen Vorerfahrungen und kontextuellen Erwartungen basiert. Mit anderen Worten: Die Wahrnehmung der äußeren Realität ist eine Mitkonstruktion einer inneren Erzählung .
Auch wenn diese Schlussfolgerung rein philosophisch klingt und möglicherweise sogar fälschlicherweise als Berkeley-Solipsismus interpretiert wird , glaube ich, dass sie neue Möglichkeiten eröffnet. Multidisziplinäre Kliniken für körperliche und psychische Erkrankungen benötigen neue Ansätze, die die Funktionsweise dieser subjektiven und körperlichen Prozesse bei Patienten klären.
Ein klares Beispiel hierfür sind Funktionsstörungen (die in der Regel Herz-Kreislauf-, Magen-Darm- oder chronische Schmerzzustände betreffen), bei denen ein Missverständnis der Ärzte über den interozeptiven oder subjektiven Zustand des Patienten häufig zu einer Übermedikation, Nachlässigkeit oder Unterschätzung des Leidens führt .
Angehörige der Gesundheitsberufe stecken oft in theoretischen und methodischen Lücken bei der Beurteilung subjektiver Krankheiten und vor allem bei der Beurteilung, wie sich diese Krankheit auf die jeweilige Wahrnehmung der Außenwelt auswirkt. Diese Leere scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass der Körper im Rahmen eines Homöostaseschemas im Dienste des Gehirns missverstanden wurde . Im Gegensatz dazu steht bei der Allostase das Gehirn aktiv im Dienst des Körpers.
Es scheint, dass das Studium der äußeren Realitäten oft unser inneres Universum leugnet. Carl Sagan erinnerte uns daran, dass wir „Sternenstaub“ sind. Noch früher, im Jahr 1929, sagte der Astronom Harlow Shapley in der New York Times, dass „unser eigener Körper aus denselben chemischen Elementen besteht, die auch in den entferntesten Nebeln vorkommen.“ Die Neurowissenschaft der Interozeption würde heute auf paradoxe und kreisförmige Weise nachbilden, dass der Kristall in unserem Körper heute den Sternen diesen besonderen Glanz zurückgibt.